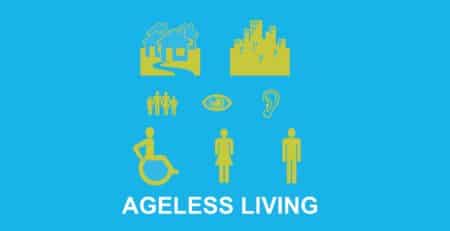Wer aufgrund einer Erkrankung oder Behinderung dauerhaft auf einen Rollstuhl angewiesen ist, kann diesen in der Regel über die gesetzliche Krankenkasse beantragen – zum Beispiel bei der AOK. Doch mit dem Rollstuhl allein ist es oft nicht getan. Erst mit einer geeigneten Rollstuhlrampen-Lösung wird echte Barrierefreiheit im Alltag möglich.
Rollstuhl beantragen bei der AOK: So funktioniert’s
Wenn die Mobilität durch eine Erkrankung oder das Alter stark eingeschränkt ist, übernimmt die AOK auf Antrag die Kosten für einen Rollstuhl. Der Weg dorthin beginnt beim behandelnden Arzt. Dieser stellt ein Rezept für einen Rollstuhl aus – je nach Bedarf als Standard-, Leichtgewicht- oder Elektrorollstuhl. Die Verordnung wird dann bei der AOK eingereicht, oft in Zusammenarbeit mit einem Sanitätshaus, das auch das passende Modell empfiehlt.
Die AOK prüft den Antrag und bezieht dabei ggf. den Medizinischen Dienst ein. Wird der Antrag genehmigt, stellt ein Vertragspartner der AOK (z. B. ein Sanitätshaus) den Rollstuhl zur Verfügung. In vielen Fällen handelt es sich dabei um eine Leihgabe, die bei Nichtgebrauch zurückzugeben ist. Auch eine Zuzahlung kann fällig werden.
Der Rollstuhl ist da – doch wie sieht es mit dem Wohnumfeld aus?
Ein häufiger Denkfehler: Mit dem Rollstuhl ist alles geregelt. Doch viele Menschen stellen schnell fest, dass sie mit dem neuen Hilfsmittel zu Hause oder unterwegs an Grenzen stoßen – zum Beispiel an der Haustürstufe, am Treppenabsatz oder bei einem nicht barrierefreien Zugang zur Garage oder Terrasse.
Auch innerhalb der Wohnung gibt es oft Hürden: schmale Türrahmen, hohe Türschwellen oder ein Bad, das nicht rollstuhlgerecht ist. Damit der Rollstuhl im Alltag komfortabel genutzt werden kann, braucht es also oft auch bauliche Maßnahmen – insbesondere Rollstuhlrampen.
Rollstuhlrampen – ein wichtiger Baustein für echte Barrierefreiheit
Rollstuhlrampen verhelfen zu einem stufenlosen Zugang zu Haus, Wohnung, Arztpraxis oder Fahrzeug. Je nach Bedarf kommen mobile Rampen, fest installierte Lösungen oder klappbare Systeme infrage.
Was viele nicht wissen: Liegt ein Pflegegrad vor, kann die Rollstuhlrampen zu 100 Prozent über die Pflegekasse finanziert werden. Alles wichtige zur Beantragung haben wir für Sie hier zusammengestellt. Auch die Krankenkasse zahlt 100 Prozent, wenn die Rampe eine Hilfsmittelnummer hat. Barrierefrei.de zeigt Ihnen, wie Sie einen Antrag für eine Rampe bei Ihrer Krankenkasse stellen.
Auch für festverbaute Rollstuhlrampen im Rahmen eines größeren Umbaus kann es einen Zuschuss geben – etwa über die Pflegekasse. Wer einen Pflegegrad hat, kann im Rahmen der „Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds“ bis zu 4.180 Zuschuss pro Umbauvorhaben erhalten. Auch bei der AOK kann ein entsprechender Antrag gestellt werden.
„Wichtig: Der Antrag sollte vor dem Einbau der Rampe gestellt werden, denn nachträgliche Kostenübernahmen sind meist ausgeschlossen“, empfiehlt Dipl.-Ing. Marco Gedert vom Portal für Rollstuhlrampen barrierefrei.de.
So kommen Sie zur passenden Rampe
- Beratung durch barrierefrei.de: Wir helfen bei der Auswahl einer passenden Rollstuhlrampen-Lösung – mobil, modular oder fest installiert.
- Kostenvoranschlag mit der Angebotsfunktion auf barrierefrei.de erstellen: Für den Antrag bei der Pflegekasse oder AOK notwendig.
- Zuschuss beantragen: Bei Pflegegrad direkt bei der AOK-Pflegekasse ggf. mit ärztlichem Attest oder Begründung der Notwendigkeit durch den MD. Bei Krankheit mit Verordnung des Arztes bei der AOK beantragen.
- Rampe einbauen lassen: Nach Genehmigung erfolgt der Einbau, ggf. durch Fachpersonal.
Rollstuhl und Rampe für mehr Mobilität
Ein Rollstuhl hilft nur dann wirklich weiter, wenn auch das Umfeld barrierefrei gestaltet ist. Deshalb gilt: Wer bei der AOK einen Rollstuhl beantragt, sollte frühzeitig auch an eine passende Rampe denken. Ob am Hauseingang, auf dem Weg zur Garage oder beim Zugang zum Garten – Rollstuhlrampen sind ein unverzichtbarer Bestandteil für ein selbstbestimmtes Leben mit Mobilitätseinschränkung.